Wer? Was? Wie? Wie weit? Warum? - Klärungsbedarf
Kategorie
Autor
Beitragsdatum
Samstag, 11. Mai 2002 - 23:00
(Der vorliegende Text ist ein Auszug aus: Selle, K. (2000): Was? Wer? Wie? Warum? - Voraussetzungen und Möglichkeiten einer nachhaltigen Kommunikation, Dortmunder Vertrieb für Bau- und Planungsliteratur, S. 141-186; Wiederveröffentlichung mit freundlicher Genehmigung durch K. Selle)


 Zur "Sache": Die Aufgabe, um die es geht, erscheint aus unterschiedlichen Perspektiven verschieden. Nehmen wir ein Beispiel: Die Emissionen eines Chemiewerkes sind für die Betreiber z. B. eine Frage von Kosten und Produktionsabläufen, für die Fachleute der Verwaltung eine Frage von Zuständigkeiten, Messverfahren, Grenzwerten, Kontrollmöglichkeiten und für die Anrainer eine Frage der Lebensqualität, die sich in so unterschiedlichen Aspekten wie Freiheit von Angst, Wert des eigenen Hauses oder Nutzung des Gemüses im Garten ausdrücken kann. Weil dies immer so ist, weil von verschiedenen "Orten" aus betrachtet ein Gegenstand (eine Aufgabe, ein Problem) immer verschieden aussieht ist ja die "Erörterung" so wichtig. Erst die verschiedenen Sichtweisen gemeinsam machen "die Sache" angemessen sichtbar (zu den rechtlichen Konsequenzen: Anhang 1)
Zur "Sache": Die Aufgabe, um die es geht, erscheint aus unterschiedlichen Perspektiven verschieden. Nehmen wir ein Beispiel: Die Emissionen eines Chemiewerkes sind für die Betreiber z. B. eine Frage von Kosten und Produktionsabläufen, für die Fachleute der Verwaltung eine Frage von Zuständigkeiten, Messverfahren, Grenzwerten, Kontrollmöglichkeiten und für die Anrainer eine Frage der Lebensqualität, die sich in so unterschiedlichen Aspekten wie Freiheit von Angst, Wert des eigenen Hauses oder Nutzung des Gemüses im Garten ausdrücken kann. Weil dies immer so ist, weil von verschiedenen "Orten" aus betrachtet ein Gegenstand (eine Aufgabe, ein Problem) immer verschieden aussieht ist ja die "Erörterung" so wichtig. Erst die verschiedenen Sichtweisen gemeinsam machen "die Sache" angemessen sichtbar (zu den rechtlichen Konsequenzen: Anhang 1)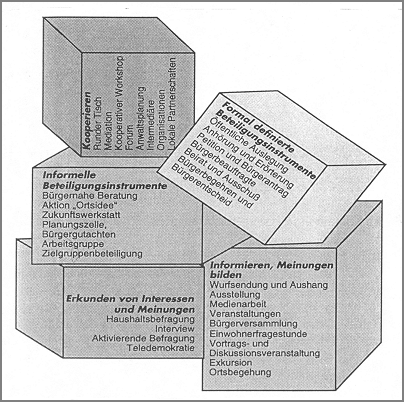 Das in der Praxis erprobte Spektrum von Kommunikationsformen ist also sehr breit. Es gibt heute kaum eine Planungs-Situation, für die nicht bereits eine sinnvolle kommunikative Gestaltungsmöglichkeit gefunden worden ist (die folgenden Autorenangaben beziehen sich wieder auf die Beispielsammlung in Selle 1996a Abschnitt C).
Das in der Praxis erprobte Spektrum von Kommunikationsformen ist also sehr breit. Es gibt heute kaum eine Planungs-Situation, für die nicht bereits eine sinnvolle kommunikative Gestaltungsmöglichkeit gefunden worden ist (die folgenden Autorenangaben beziehen sich wieder auf die Beispielsammlung in Selle 1996a Abschnitt C). Arnstein (1969) mit der berühmten "ladder of citizen participation" formuliert. Ich habe diese "Leiter" hier inhaltlich und formal ein wenig modifiziert, ohne an der grundsätzlichen Abfolge etwas zu verändern (vgl. Abb. 6-4):
Arnstein (1969) mit der berühmten "ladder of citizen participation" formuliert. Ich habe diese "Leiter" hier inhaltlich und formal ein wenig modifiziert, ohne an der grundsätzlichen Abfolge etwas zu verändern (vgl. Abb. 6-4): Frühwarnfunktionen habe. Heute sind die Verwendungsmöglichkeiten der Beteiligung (und mithin deren Ambivalenz bekannt und daher lässt sich nüchtern feststellen: Wer rechtzeitig über Planungsabsichten informiert, wird frühzeitig in Erfahrung bringen, ob mit Widerständen zu rechnen ist. So lassen sich die Pläne noch ver- hältnismäßig unaufwendig ändern oder Möglichkeiten zur Akzeptanzförderung (z. B. durch ausführlichere Begründung) bzw. zur Minderung des sich abzeichnenden Protests prüfen. Noch sinnvoller wäre es natürlich, die Planungsabsichten selbst kooperativ zu entwickeln. Dann bedürfte es des Resonanztests nicht.
Frühwarnfunktionen habe. Heute sind die Verwendungsmöglichkeiten der Beteiligung (und mithin deren Ambivalenz bekannt und daher lässt sich nüchtern feststellen: Wer rechtzeitig über Planungsabsichten informiert, wird frühzeitig in Erfahrung bringen, ob mit Widerständen zu rechnen ist. So lassen sich die Pläne noch ver- hältnismäßig unaufwendig ändern oder Möglichkeiten zur Akzeptanzförderung (z. B. durch ausführlichere Begründung) bzw. zur Minderung des sich abzeichnenden Protests prüfen. Noch sinnvoller wäre es natürlich, die Planungsabsichten selbst kooperativ zu entwickeln. Dann bedürfte es des Resonanztests nicht.