Förderung der Partizipation von Zuwanderern im Stadtteil
Kontakt:
- Prof. Dr. Gaby Straßburger, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin, Köpenicker Allee 39-57, 10318 Berlin, Tel. 030/ 501010912, Email: strassburger@khsb-berlin.de
- Can Aybek, M.A., Graduate School of Social Sciences, Universität Bremen, FVG-West, Wiener Straße/Ecke Celsiusstrasse, 28334 Bremen, Tel. 0421/2184166, Email: aybek@gsss.uni-bremen.de
Wie lässt sich die Partizipation von Zuwanderern im Stadtteil fördern? Unsere Ausführungen ranken sich um eine zentrale These, die uns ziemlich selbstverständlich erscheint, aber – wie die Erfahrung zeigt – doch ziemlich umstritten ist. Sie lautet: Bei der aktivierenden Arbeit mit Zuwanderern geht es nicht um besondere Methoden der Partizipationsförderung. Es geht vielmehr darum, die Methoden, mit denen wir bei der Partizipationsförderung ganz allgemein arbeiten, auch bei Zuwanderern ernsthaft und zielgruppenadäquat anzuwenden.
Deshalb wollen wir zu Beginn erst einmal ganz allgemein fragen: "Wie lässt sich die Selbstorganisation und aktive Beteiligung von Betroffenen am öffentlichen Leben unterstützen?" Wir werden diesbezüglich einige Leitlinien umreißen, die im wesentlichen auf Kerngedanken von Wolfgang Hinte und Dieter Oelschlägel beruhen 1). Danach stellen wir einige Beispiele aus der praktischen Arbeit mit Zuwanderern im Stadtteil vor, die wir als Stadtteilmoderatorin in Essen und als Gemeinwesenarbeiter in München gewonnen haben. Wir wollen daran verdeutlichen, inwiefern migrations- bzw. migrantenspezifische Aspekte bei der Förderung der Partizipation von Zuwanderern zum Tragen kommen. Doch zunächst ganz allgemein: Wie kann man Partizipation fördern?
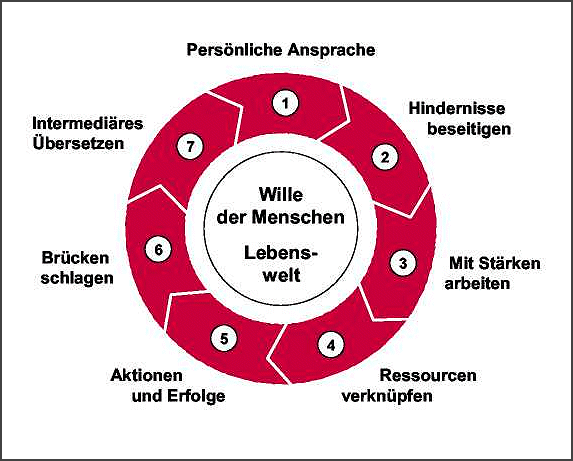
Abbildung 1: Zentrale Aspekte der Partizipationförderung
Um sicherzustellen, dass alle Bewohnergruppen gleichberechtigt an der Gestaltung der Lebensbedingungen eines Stadtteils partizipieren können, gilt es Dialoge zu initiieren und zu moderieren, d. h. dafür zu sorgen, dass alle mitreden und mitmischen können. Dafür ist es notwendig auf die Bewohner zuzugehen, eine persönliche Beziehung zu ihnen aufzubauen und Hindernisse zu beseitigen, die es einem Teil der Stadtteilbevölkerung schwer machen, ihre Interessen zu artikulieren.
Es gilt, den Blick bewusst auf Stärken und Ressourcen zu richten, nicht auf Schwächen und Defizite. Dazu gehört, die Stärken von Bewohnern und die Ressourcen des Stadtteils sichtbar zu machen, sie miteinander zu verknüpfen und sie für gemeinsame Belange zu aktivieren. Wichtig ist auch, sich darum zu kümmern, dass nicht nur geredet wird, sondern wirklich etwas rauskommt und dass das erzielte Ergebnis von Dauer ist; oder wie es seit der Agenda 21 heißt: nachhaltig. Es müssen Aktionen in Gang kommen und Erfolge erzielt werden.
Insgesamt geht es um eine "intermediäre Tätigkeit", d. h. darum Brücken zu schlagen. Brücken zwischen den verschiedenen Milieus, Kulturen und Lebenswelten innerhalb des Stadtteils und Brücken zwischen den Realitäten der Bewohner und Bewohnerinnen auf der einen Seite und den Realitäten von Verwaltung, Politik und Wirtschaft auf der anderen. Man muss die verschiedenen Welten miteinander in Kontakt bringen und versuchen, eine Verständigung zu ermöglichen. Da jede dieser Welten eine eigene Sprache pflegt, besteht die intermediäre Aufgabe darin, die Anliegen der verschiedenen Akteure in die Sprache der verschiedenen Adressaten zu "übersetzen" und so zu garantieren, dass die Botschaft richtig ankommt.
Dreh- und Angelpunkt ist der Wille der Menschen und der Zugang zu ihrer Lebenswelt. Wenn wir nun also in einem zweiten Schritt danach fragen, wie sich die Partizipation von Zuwanderern sicherstellen lässt, müssen wir uns zunächst darüber Gedanken machen, wie ihre Lebenswelt aussieht.
Dabei stellen wir schnell fest, dass sie in vielerlei Hinsicht der von anderen Bewohnergruppen ähnelt:
- sie ist ebenso schicht-, bildungs- und einkommensspezifisch geprägt und
- sie ist gleichermaßen vom Geschlecht, Alter und Familienstand beeinflusst.
Sprich, sie zeichnet sich durch eine enorm hohe interne Vielfalt aus. Deshalb wird es in der Praxis immer darum gehen, Partizipationsförderung auf konkrete Menschen mit konkreten Ressourcen in einem konkreten Kontext abzustimmen. Es erscheint daher hilfreich, ein konkretes Praxisbeispiel heranzuziehen. Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen des Quartiermanagements von Essen-Katernberg. Im Jargon des Programms "Soziale Stadt" würde man sagen, dass es in das Handlungsfeld "Verbesserung der Stadtteilinfrastruktur und des Wohnumfeldes" fällt. Es stellt eine Reaktion darauf dar, dass ein Teil der vorhandenen Infrastruktur in absehbarer Zeit weg brechen sollte. Konkret ging es um 40 Gärten. Gärten, die türkischen Stadtteilbewohnern als Freizeit- und Erholungsort dienen und ihnen die Möglichkeit bieten, Lebensmittel zu produzieren. Lebensmittel, die nicht immer nur dem Eigenbedarf dienen, sondern bisweilen auch eine zusätzliche Ressource der Existenzsicherung bilden. Insofern weist das Projekt auch einen Bezug zur "Gemeinwesenökonomie" auf.
Eine andere Lesart des Praxisbeispiels könnte lauten, es handelt sich um den Versuch von Zuwanderern sich in das – nicht nur in Essen – bislang nahezu ausschließlich von einheimischen Deutschen beherrschte Kleingartenwesen zu integrieren. Dass das nicht ohne Probleme ging, braucht man vermutlich gar nicht erst zu sagen.
Das Projekt begann damit, dass das Stadtteilbüro in Essen-Katernberg im Frühjahr 2002 erfuhr, dass 40 Schrebergärten, die türkische Stadtteilbewohner im Lauf vor ca. 30 Jahren angelegt haben, innerhalb der nächsten drei Jahre geräumt werden müssen. Es handelt sich um Schrebergärten auf einem Gelände der Stadt Gelsenkirchen, das unmittelbar an den Essener Stadtteil Katernberg grenzt. Gelsenkirchen benötigt dieses Gelände als Ausgleichsfläche und hat daher die Räumung der Gärten beschlossen. Die Photos vermitteln einen Eindruck, wie die Gärten ungefähr aussehen.


 Abbildungen 2-4:
Abbildungen 2-4:
Schrebergarten-Idylle
Es lässt sich ohne Probleme erkennen, dass diese Gärten relativ wenig Ähnlichkeit mit einer typischen Kleingartenanlage aufweisen. Sie wurden ohne behördliche Genehmigung in den 70er Jahren von türkischen "Gastarbeitern" – wie sie damals hießen – angelegt, die dafür eine Brachfläche entrümpelt und urbar gemacht haben. Anfang der 80er Jahre drohte die Stadt Gelsenkirchen, der das Gelände gehört, mit der Räumung, ließ sich aber umstimmen und schloss Pachtverträge mit den Gartennutzerinnen. Allerdings mit der ausdrücklichen Auflage, auf keinen Fall Gartenlauben, Gewächshäuser, Brunnen oder ähnliches zu installieren. Eine Auflage, von der natürlich alle Beteiligten wussten, dass niemand sie einhalten würde, denn die Lauben standen ja bereits und wurden auch in den nächsten Jahren geduldet.
Die Verträge können jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen gekündigt werden, so dass man sich fragt, warum sich die Zuwanderer auf diese Verträge eingelassen haben, statt sich nach Gärten umzusehen, die rechtlich abgesichert sind. Nun, das haben einige durchaus versucht. Doch fehlten ihnen entweder die finanziellen Mittel, um die ortsüblichen Ablösesummen für Kleingärten zu zahlen – da ist man schnell bei 5.000 Euro – oder aber sie bekamen angesichts ihrer ausländischen Herkunft immer wieder zu hören, dass in der Anlage "im Moment gerade kein Platz frei" sei. In den Kleingartenvereinen war es über Jahrzehnte hinweg üblich, Zuwanderer, die sich für einen Garten interessierten, abzuweisen, selbst wenn Parzellen über längere Zeit nicht abgegeben werden konnten.
Wir konstatieren hier verdeckte Diskriminierung als Hindernis, das es Zuwanderern schwer macht, sich in das lokale Vereinsleben zu integrieren und dort aktiv mitzumischen.
Als das Stadtteilbüro erfuhr, dass die 40 Gärten geräumt werden sollen, stellte sich als erstes die Frage: Wie kommen wir an die Gartenpächterlnnen heran, um sie möglichst schnell darüber zu informieren? Da sie nicht organisiert waren – weder als Verein, noch sonst in irgendeiner Form -, gab es natürlich auch keine Ansprechpartner, an die wir uns stellvertretend hätten wenden können und so blieb uns wenig anderes übrig als immer wieder zu den Gärten zu gehen und die Leute, die wir antrafen, einzeln über das Räumungsvorhaben zu informieren.
Ich begann also, bei schönem Wetter die Gärten aufzusuchen, mich vorzustellen und zu erklären, dass ich vom Stadtteilbüro komme 2). Nach einigen Höflichkeitsfloskeln fragte ich meine Gesprächspartner, ob sie denn regelmäßig hierher kämen, wie lange sie ihren Garten schon hätten, usw. Oft folgte schon nach kurzem die Einladung zu einem Glas Tee und im Lauf der Gespräche erfuhr ich einiges über die biographischen und familiären Hintergründe der Pächter. Zudem erkundigte ich mich danach, mit welchen anderen Pächtern sie Kontakt haben und wer sich hier am besten auskenne. Die geplante Räumung brachte ich erst ins Gespräch, wenn wir uns »warm« geredet hatten. Denn ich wollte vermeiden, sofort "mit der Tür ins Haus zu fallen".
Diese Gespräche dienten dazu, einen persönlichen Kontakt herstellen und einen Eindruck davon zu bekommen, wie wichtig die Gärten für die einzelnen Familien sind. Zudem konnte ich erkennen, dass die Pächter untereinander bisweilen recht enge, im Großen und Ganzen aber doch überraschend lose Sozialkontakte hatten. Und ich stieß auf zwei Personen, die offenbar stärker als andere über alles informiert waren, was sich in den Gärten tat.
Diese beiden, eine 55jährige Frau und ein 40jähriger Mann, wurden bald unsere wichtigsten Ansprechpartner. Sie hatten beide großes Interesse, die Gärten zu erhalten und sich gegen die drohende Räumung zu wehren. Beide verfügten über wichtiges soziales Kapital, zum einen über eine zentrale Position im losen Beziehungsgefüge der Pächterfamilien, und zum anderen über die Kompetenz, andere zu mobilisieren. Im "community organizing" würde man sagen, sie hatten das Zeug zum »leader«.
Nachdem sie von der Räumungsabsicht erfahren hatten, wurden sie nicht müde, andere PächterInnen dazu zu bewegen, sich im nahe gelegenen Stadtteiltreff zu versammeln, um sich zu informieren und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Zu diesen Versammlungen kamen jeweils 15-20 Frauen und Männer, wobei die Zusammensetzung stark schwankte. Das lag unter anderem daran, dass ältere Leute, die nicht mehr arbeiten, gerne für längere Zeit in die Türkei fahren. Denn der soziale Raum, in dem sich Zuwanderer bewegen, reicht oft auch ins Herkunftsland. Ein Phänomen, das der Soziologe Ludger Pries als Leben in "transnationalen sozialen Räumen" bezeichnet und das es bei der Arbeit mit Zuwanderern zu berücksichtigen gilt.
Vor den Versammlungen wurden jeweils Einladungen durch das Stadtteilbüro versandt, die jedoch, obwohl in türkischer Sprache verfasst und zeitnah verschickt, nur relativ geringe Wirkung zeigten. Viel effektiver war es, wenn die beiden Schlüsselpersonen kurz vor der Versammlung bei den Leuten anriefen. Auch dies ein bekanntes Phänomen aus der Arbeit mit Migrantenfamilien. Wir kennen es allerdings auch von vielen anderen Familien jenseits des Bildungsbürgertums: der Vorrang der mündlichen vor der schriftlichen Kommunikation bzw. die Tatsache, dass Einladungen, die schriftlich verfasst sind, nicht als einladend verstanden werden. Denn wirkliche Einladungen erfordern die persönliche und bisweilen nachdrückliche Aufforderung durch vertraute Personen, "doch auf jeden Fall zu kommen!" Wer sich dagegen ausschließlich auf schriftliche Einladungen verlässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn bestimmte Teile der Stadtteilbevölkerung nicht zu den Veranstaltungen kommen.
Die Versammlungen mit den Gartenpächterlnnen im Stadtteilbüro waren sehr lebhaft und erforderten ziemliches Durchsetzungsvermögen der Moderation. Zudem wurde deutlich, dass viele Betroffene von der Komplexität des Problems überfordert waren. So sehr die Professionellen auch versuchten, alles so einfach und plastisch wie möglich darzustellen, tatkräftig unterstützt von den beiden Schlüsselpersonen, blieb es für viele trotzdem zu abstrakt und lag zudem in allzu ferner Zukunft. Außer heißen Diskussionen – oft gekoppelt mit diversen Verschwörungstheorien – kam anfangs wenig dabei rum. Es war also keineswegs einfach, die intermediäre Funktion auszufüllen und eine Brücke zu schlagen zwischen Politik und Verwaltung auf der einen und den Stadtteilbewohnern auf der anderen Seite 3).
Nun stellt sich dieses Problem keineswegs nur in der Arbeit mit Zuwanderern, sondern bei vielen Menschen, die stärker als andere von politischen und bürokratischen Eingriffen in ihre Lebenswelt betroffen sind. Denn sie wissen aus Erfahrung, dass sie »von dort nichts Gutes zu erwarten haben«. In solchen Fällen ist es deshalb immer eine Herausforderung, die innere Abwehr aufzuweichen, und den Menschen dadurch die Möglichkeit zu eröffnen,
- nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist,
- darüber nachzudenken, was sie jetzt tun wollen und
- wer aus Politik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft etc. möglicherweise ihre Bündnispartner sein könnten.
Bei Zuwanderern kommt u. U. noch dazu, dass die innere Abwehr durch vielfältige Diskriminierungserfahrungen verstärkt wird und dass sie möglicherweise einiges falsch verstehen, weil sie a) zum Teil die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen oder b) von anderen Rahmenbedingungen ausgehen. So ist beispielsweise das Besetzen von Brachflächen in der Türkei weit verbreitet und wird häufig durch die Behörden im Nachhinein legalisiert.
Damit zurück zu unserem Beispiel: Deutlich konkreter wurde das Ganze, als die Pächter mit dem Lösungsvorschlag konfrontiert wurden, den die Essener Stadtverwaltung und Kommunalpolitik erarbeitet hatten. Er sah vor, einen Verein zu gründen und in Essen-Katernberg eine eigene Kleingartenanlage aufbauen. Nun regte sich ein Sturm der Entrüstung: Das hieße ja, die Gärten aufzugeben! Nein, dazu wäre man auf keinen Fall bereit! Zum ersten Mal zeigte sich bei allen PächterInnen deutlich der Wille, für den Erhalt der Gärten zu kämpfen. Innerhalb von zwei Monaten hatten sie 1200 Unterschriften gesammelt, und übergaben sie – im Beisein der deutschen und türkischen Presse – dem Gelsenkirchener Oberbürgermeister.
 Abbildung 5: Unterschriftensammlung beim Zechenfest |
 Abbildung 6: Protest im Rathaus |
Dieser Wendepunkt von der folgenlosen Diskussion zur deutlichen Formulierung eines gemeinsamen Willens und zur tatkräftigen Aktion hat vermutlich viel damit zu tun, dass es aufgrund des Essener Lösungsvorschlags ein klares Szenario gab. Es ging aber zum damaligen Zeitpunkt eindeutig am Willen der PächterInnen vorbei, und hatte zur Folge, dass ihnen erst richtig klar wurde, dass sie selbst aktiver werden mussten. Nach einigen erfolglosen und teilweise ziemlich diskriminierenden Begegnungen mit Gelsenkirchener Politikern sahen sie aber schließlich ein, dass ihr Protest vergebens sein würde.
Daraufhin beschlossen die meisten, sich nun doch in einem Verein zu organisieren und in Essen eine interkulturelle Kleingartenanlage aufzubauen. Mit Hilfe des Katernberger Quartiermanagements nahmen sie Kontakt zum Essener Kleingartenverband auf. Dieser hatte zufälligerweise gerade eine Brachfläche erworben, für die er keine Verwendung hatte, so dass er sie den türkischen Familien zur Pacht anbot. Diese sahen darin eine große Chance, aber sie gerieten auch in einen ziemlich großen Handlungsdruck. Denn jetzt musste innerhalb von wenigen Wochen ein Verein gegründet werden und außerdem mussten in relativ kurzer Zeit grundlegende organisatorische und finanzielle Entscheidungen getroffen werden.
Hier stoßen wir auf ein weiteres Hindernis, das es vielen Zuwanderern erschwert, im lokalen Vereinsleben aktiv mitzumischen: Oft fehlen ihnen biographische Vorerfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit, Schülervertretung, Sportverein, Parteiarbeit etc. auf die viele Einheimische aufbauen können. Dagegen wissen viele Zuwanderer kaum etwas darüber, wie ein Verein funktioniert, geschweige denn darüber, wie man einen Verein gründet und leitet.
Daraus folgt, dass Akteure, die Zuwanderer dabei unterstützen wollen, im Stadtteil aktiv zu werden, erst einmal eine ganze Menge kreativer Aufbauarbeit leisten müssen. Das kann durch Fachkräfte und Berater nicht-deutscher Herkunft wesentlich erleichtert werden, die neben Sprach- und Kulturkenntnissen auch noch einen besonderen Vertrauensbonus besitzen.
Deshalb hat sich das Stadtteilbüro darum gekümmert, jemanden zu finden, der für Stadtteilarbeit qualifiziert ist, sich mit Vereinsgründungen auskennt und selbst aus der Türkei stammt. Er wurde im Rahmen eines Werkvertrags engagiert, um die Mitglieder des Vereinsvorstandes, die bislang über keinerlei Erfahrungen im Vereinswesen verfügten, zu begleiten und ihre neuen Funktionen einzuüben.
Drei Monate später hatte der Verein genügend Mitglieder, um eine Kleingartenanlage aufbauen zu können und die Vereinsmitglieder konnten mit der Rodung des neuen Geländes beginnen. Für das Projekt ein wichtiger Schritt! Denn jetzt wurden endlich Nägel mit Köpfen gemacht und das bloße Reden hatte ein Ende.
 Abbildung 7: Rodungsarbeiten |
 Abbildung 8: Endlich werden Nägel mit Köpfen gemacht! |
Zudem konnten die meisten ihre Ressourcen hier weit besser einbringen als bei den Versammlungen. Viele arbeiten in der Baubranche oder kennen schwere landwirtschaftliche Tätigkeiten noch aus dem Herkunftsland. Außerdem kam jetzt der starke familiäre Zusammenhalt der Vereinsmitglieder zum Tragen. Denn zu den Arbeiten, die jeden Samstag – oft bei eisigen Temperaturen, es war schließlich Januar! – stattfanden, kamen in vielen Fällen die Söhne und Schwiegersöhne, um stellvertretend für ihre Eltern das Grundstück vorzubereiten.
Dieses Praxisbeispiel enthält eine Menge Anhaltspunkte dafür, wie Stadtteilarbeit Zuwanderer dabei unterstützen kann, öffentlich aktiv zu werden. Es verdeutlicht darüber hinaus, dass Beteiligung eine ganze Menge kreativer Aufbauarbeit erfordert, wenn eine Zielgruppe noch wenig bzw. keinerlei Vorerfahrung damit hat.
Im Kern geht es darum, das gut zu machen, was wir eingangs dargestellt haben:
- Die Menschen persönlich anzusprechen,
- auftretende Hindernisse zu beseitigen,
- mit den Stärken der Menschen zu arbeiten,
- verschiedene Ressourcen zu verknüpfen,
- für Aktionen und Erfolge zu sorgen,
- Brücken zwischen verschiedenen Welten zu schlagen,
- und hin und her zu übersetzen.
Zu Beginn haben wir erwähnt, dass es notwendig ist, sich Gedanken über die Lebenswelt von Migrantinnen und Migranten zu machen, wenn wir ihre Partizipation sicherstellen wollen. Wir wollen nun detaillierter darauf eingehen, was es bedeutet, dass ein Beteiligungsvorhaben sich an der Lebenswelt von Zuwanderern orientieren und deren Willen berücksichtigen sollte.
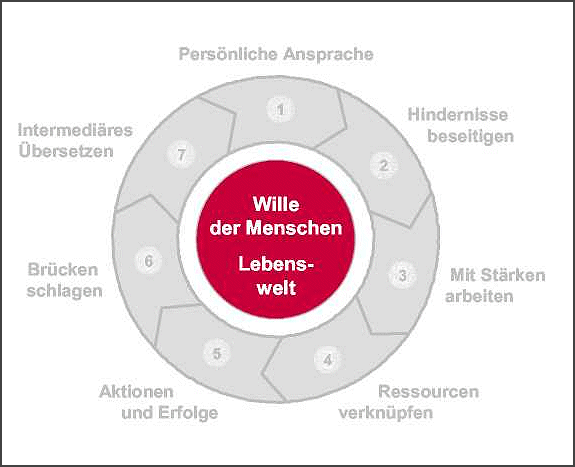
Abbildung 9: Die Lebenswelt und der Wille der Menschen im Zentrum der Partizipationsförderung
Mit dem Begriff "Lebenswelt" soll in diesem Zusammenhang verdeutlicht werden, dass Menschen und Gruppen eine jeweils unterschiedliche Wahrnehmung ihrer Umwelt haben. Diesen Lebenswelten der einzelnen Personen oder Gruppen steht die Gesellschaft als politisch-administratives System gegenüber, das nach eigenen Logiken und Zweckrationalitäten funktioniert. Bürokratien und ähnliche formale Strukturen sind ein gutes Beispiel dafür. Die Sprache der Professionellen ist voll von Begriffen, die darauf Bezug nehmen.
Obwohl Menschen in derselben Umwelt bzw. Umgebung leben und tätig sind, können sie die Funktion von Institutionen und Prozessen anders wahrnehmen als vom System beabsichtigt. Der Sinn, den die Menschen mit diesen Institutionen und Prozessen verbinden, hängt stark von ihrer Biografie, dem Milieu, in dem sie sich bewegen, ihrem Geschlecht, ihrer Lebensphase, ihrem sozialen Status und auch ihrem kulturellen Hintergrund zusammen. Deswegen ist es bei Beteiligungsverfahren wichtig, nicht automatisch von einer gemeinsamen oder geteilten Zielsetzung oder Stoßrichtung auszugehen.
Dies steht in direktem Zusammenhang mit einem weiteren Begriff, den wir hier anführen: Das Angebot zur Beteiligung muss den Willen der jeweiligen Zielgruppe berücksichtigen, es muss sich unbedingt auf die Interessen der zu Beteiligenden beziehen. Auch hier soll an einigen Beispielen 4) verdeutlicht werden, wie man diesen bislang abstrakten Empfehlungen in der Praxis nachkommen kann.
Wir haben alle eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Lebensgestaltung von Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland aussieht. Dabei verallgemeinern wir Beispiele, die wir aus unserer Umgebung kennen. Wir können uns also vorstellen, wie der Alltag einer deutschen Rentnerin aussieht und dies bei unserer Arbeit im Stadtteil berücksichtigen. Wie sieht es aber im Falle eines griechischen Rentners aus? Was macht ein ehemaliger griechischer Industriearbeiter, wenn er nicht mehr arbeiten muss? Was wir in unserer Arbeitspraxis immer wieder mitbekommen haben, war, dass im Unterschied zu "bürgerlichen" Rentnern diese Gruppe kein gezieltes Freizeitverhalten, keine entwickelten Hobbys hatte. Dies ist vielleicht keine Besonderheit von "Griechen" sondern einfach nur schichtspezifisch. In seinem Heimatdorf würde ein griechischer Rentner ins Kafeníon oder auf die Dorf-Piazza gehen.
In München stellt sich ihm eine andere Situation: Wenn er sich dazu entscheidet, in griechische Lokale zu gehen, um andere Gleichgesinnte zu treffen, müsste er relativ viel Geld ausgeben. Denn es würde dort Konsumzwang bestehen. Er könnte nicht einfach dasitzen. Aus dieser Beobachtung entstand die Idee, eine griechische Besuchergruppe im Alten- und Servicezentrum, kurz ASZ, zu etablieren. Aus einer anderen Perspektive heißt das natürlich, eine Öffnung derselben Institution voranzutreiben. Es geht hier also um ein Beteiligungsvorhaben.
Zu Beginn entschied sich mein Kollege, die Rentner mit Filmvorführungen ins ASZ zu "locken". Dabei handelte es sich um alte griechische Filme, die diese Menschen noch aus ihrer Jugend kannten. Die Nachricht, dass Filmabende stattfinden würden, wurde auf sehr effiziente Weise über ein Beratungsbüro im Stadtteil bekannt gemacht, dessen Dienste diese Gruppe sehr häufig in Anspruch nahm. Durch den unverbindlichen Rahmen einer Einladung zu einem nostalgischen Kinoabend konnte das Interesse leicht geweckt werden.
Dazu muss man sagen, dass das Alten- und Servicezentrum für diese Gruppe, die seit Jahrzehnten in diesem Stadtteil wohnt, eine weitgehend unbekannte Institution war. Einer der Besucher soll beispielsweise im Anschluss an einen solchen Kinoabend gesagt haben: "Seit 20 Jahren gehe ich hier vorbei. Und ich dachte, es wäre ein deutsches Altenheim. Nur für Deutsche."
In Absprache mit der Leitung des ASZs wurden anschließend Nachmittage für die griechische Besuchergruppe eingerichtet. Nachdem die Gruppe gesehen hatte, die Atmosphäre im ASZ ist entspannt und sie können Tätigkeiten nachgehen, denen sie auch in einem Kafeníon nachgehen würden, nämlich Karten oder Tavli spielen und sich über die Tagesereignisse austauschen, kamen immer mehr.
Allerdings gab es auch einige Schwierigkeiten: Beispielsweise war das Rauchen ein Problem. Hier musste das ASZ verschiedene Lösungsoptionen ausprobieren, d. h. "Phantasie" im Umgang mit dieser Besuchergruppe zeigen. Zur Seite stand ihnen dabei immer das Beratungsbüro, auf dessen Initiative die Gruppe eingeführt worden war. Am Ende wurden es dann fast zu viele Leute.
Dieses Beispiel zeigt vor allem eines ganz klar: Hier wurde ein Bedarf gedeckt. Die Gruppe der älteren Zuwanderer wurde in die Angebote einer Regelinstitution im Stadtteil eingebunden. Es zeigt aber auch: Um die Beteiligung einer Migrantengruppe sicherzustellen, müssen wir eine Vorstellung davon haben, wie die Bedürfnisse dieser Gruppe aussehen und wir müssen beurteilen können, inwiefern Schnittmengen zwischen ihren Interessen und unseren Zielsetzungen bestehen.
Ein weiteres Beispiel aus der Münchener Stadtteilarbeit kann dazu dienen, diesen Punkt weiter zu verdeutlichen: In Milbertshofen tauchte Ende der neunziger Jahre relativ überraschend eine vollkommen neue Gruppe von Zuwanderern auf, die anfing, die Beratungsdienste des Stadtteilbüros in Anspruch zu nehmen. So genannte »Rossopontier«, was sinngemäß mit dem Begriff "griechische Spätaussiedler" übersetzt werden könnte. Wir hatten anfangs Schwierigkeiten diese Gruppe einzuordnen, da sie zwar griechische Staatsangehörige waren, aber untereinander Russisch und hauptsächlich einen eigenartigen, etwas altmodischen östlichen Dialekt des Türkischen sprachen. Viele von ihnen konnten entweder kein oder ein eher gebrochenes Griechisch. Da die Zahl dieser Menschen stetig zunahm, versuchten wir sie als Büro gezielt anzusprechen, um mehr über sie zu erfahren, sie in unsere Angebotsstruktur einzubinden und uns besser auf ihre Situation einstellen zu können.
Die Geschichte der Rossopontier ist etwas kompliziert (s. Abb. 10). Sie sind ursprünglich griechischer Herkunft, haben allerdings über Generationen hinweg – genauer bis zur Auflösung der UdSSR – in Georgien gelebt. Dorthin waren sie aufgrund von Kriegen im 19. Jahrhundert geflüchtet. Ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet lag in der östlichen Schwarzmeerregion der heutigen Türkei. Daher die Verständigungssprache Türkisch. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verließen sie – zum Teil aufgrund eines erstarkenden georgischen Nationalismus im nun unabhängigen Georgien – ihre Heimat und gingen nach Griechenland, wo sie als Griechischstämmige aufgenommen wurden. Einige von ihnen richteten sich in Griechenland ein und ließen sich dort nieder. Andere wiederum entschieden sich dafür, als EU-Bürger ihr Glück in anderen Ländern Europas, also z. B. Deutschland, zu versuchen. Das alles war uns allerdings anfangs keineswegs bekannt.
 Abbildung 10: Wanderungswege der »Rossopontier« |
Um diese neue Gruppe kennen zu lernen und ihnen das Büro vorzustellen, kündigten wir eine Abendveranstaltung mit Essen, Musik und Gesprächen an. Über die Personen, die zu uns in die Beratungsstunden kamen, versuchten wir die Veranstaltung bekannt zu machen. Wir wollten auf jeden Fall vermeiden, als eine Art "Behörde" wahrgenommen zu werden. Deshalb deklarierten wir das Ganze zum "Willkommensabend des Büros für Rossopontier" und forderten die Leute auf, sich organisatorisch daran zu beteiligen, beispielsweise Essen mitzubringen.
Die gezielte Ansprache auf persönlicher Ebene, aber auch das Willkommen-Heißen der Gruppe hat bewirkt, dass die Veranstaltung gut besucht war. Auffällig war allerdings, dass fast keine Frauen und Kinder kamen, und viele Gäste sich zu Anfang des Abends relativ reserviert zeigten. Uns wurde klar, dass die Rossopontier zu diesem Treffen – quasi – eine Art "Vorhut" geschickt hatten, um zu erfahren, was denn dahinter steckt. An diesem Abend kamen – und das war für uns wichtig – auch einige Familienältere. In der englischsprachigen Migrationsforschung würde man diese Personen als "ethnic leader" bezeichnen. Der angenehme Verlauf des Abends führte dazu, dass diese Familienälteren den anderen ihre Zustimmung signalisierten. So nach dem Motto: "Die sind in Ordnung. Dahin könnt ihr gehen."
Das ist nicht als selbstverständlich zu sehen, denn es gab viele Familien innerhalb dieser Gruppe von Neuzuwanderern, die sich in schwierigen, teilweise sehr prekären Situationen befanden, so dass der Kontakt zu Institutionen der Mehrheitsgesellschaft für sie ein sensibles Thema war. Dazu gehörte die extreme Überbelegung von Wohnungen, irreguläre Arbeitsverhältnisse, wo Arbeitgeber ausstehende Lohnansprüche nicht beglichen haben, usw. Nach dieser Willkommensveranstaltung erhöhte sich die Zahl derer erheblich, die die Beratungsdienste des Stadtteilbüros in Anspruch nahmen.
Um es also nochmals zusammenzufassen: Durch persönliche Ansprache und die Würdigung der Gruppe gelang es uns an diesem Abend, diese Gruppe für uns zu gewinnen. Wir konnten eine Menge wichtiger Informationen über die Gruppe zusammentragen: Wir erfuhren beispielsweise, dass wir es mit ausgeprägten Großfamilienstrukturen zu tun hatten und die Gruppe deshalb von einer starken Kettenmigration betroffen war. Dies wiederum führte zur Überbelegung von Wohnräumen, wo teilweise drei Generationen gemeinsam wohnen mussten. Zu diesen Problemen kamen noch ganz alltägliche Angelegenheiten, mit denen sich Neuzuwanderer auseinander setzen müssen: für die Kinder mussten die richtigen Schulen gefunden werden; für die Älteren mussten Gesundheitsdienste sichergestellt sein. Wir waren ganz sicher nicht in der Lage, Lösungen für alle diese Fragen bereitzustellen. Aber es war ein guter Anfang gemacht, und die Kooperation zwischen dieser Zuwanderergruppe und dem Stadtteilbüro war in Gang gekommen.
Hier gilt es zu betonen, dass wir in unserer Arbeit nicht nur an der "Stabilität der Nachbarschaft", oder am "friedlichen Miteinander" von allen Menschen im Stadtteil interessiert waren, wie es in allgemeinen und abstrakten Zielsetzungen öfters formuliert wird, sondern wir waren an den ganz konkreten Problemen und Bedürfnissen der Zuwanderer interessiert. Deshalb lassen sie uns in einem Zwischenfazit festhalten: Die intermediäre Tätigkeit beinhaltet vor allem die Wahrnehmung und Berücksichtigung der Interessen der Zielgruppe (hier: der Migrantinnen und Migranten).
Ein drittes Beispiel aus München mag verdeutlichen, wie dies in Bezug auf die Wohnsituation in einem Stadtteil aussehen kann. In der Moosacher Straße waren vier Behelfsbauten, die ursprünglich für deutsche Aussiedler (sog. "Ostflüchtlinge") eingerichtet worden waren. Der Bau stand neben einem Wäschereibetrieb. Dieser hatte während der Anwerbephase Arbeiterinnen und Arbeiter aus Griechenland geholt und diese in den Behelfsbauten untergebracht. Ein großer Teil von ihnen kam aus einem einzigen Dorf am Olymp (Kokinopilos) in Griechenland. In den Behelfsbauten lebten mittlerweile fast nur noch Griechen und die Umstände dort waren katastrophal. Zudem stimmten die Mietabrechnungen nicht. Die Bewohner gingen allmählich auf die Barrikaden. Sie wandten sich zuerst an eine ethnisch definierte Beratungsstelle (das "Griechische Haus"), die sich allerdings regional und von der Problemlage her nicht zuständig fühlte. Sie leitete die Angelegenheit an das Stadtteil-Büro weiter.
Um die Beteiligten kennen zu lernen, wurde deshalb in einem ersten Schritt ein Treffen in einer nahe liegenden Gaststätte vereinbart. In den Gesprächen an diesem Abend konnten zwar keine konkreten Ergebnisse erzielt werden, aber die Mieter schienen sich untereinander einig zu sein, dass etwas getan werden muss. Augenfällig war, dass einige Mitglieder der Gruppe sich auf Griechisch gut artikulieren konnten, so dass sie also in der Lage waren als Wortführer zu agieren.
Im Anschluss an dieses Treffen und im weiteren Austausch entstand dann die Überlegung, einen Mieterverein zu gründen. Das Büro sah seine Rolle darin, den betroffenen Familien auf diese Weise zur Seite zu stehen. So entstand der "Mieterverein Moosacher Str. e. V." und der Wäschereibetrieb hatte damit einen Widerpart. Dieser Verein hat dann einen Anwalt eingeschaltet. Mit dem Erfolg, dass Ruhe einkehrte. Die Abrechnungen wurden fortan richtig gemacht, etc.
Auch dies ein Beispiel für eine nicht gerade untypische Situation: Es kommen viele, ähnlich gelagerte Einzelfälle zusammen. Alle Betroffenen gehen zunächst davon aus, dass es sich um ihr persönliches Einzelproblem handelt. Die Neigung, sich zu organisieren, ist nicht von Anfang an gegeben. Die passende "deutsche" Lösung war dann eben, diesen Verein zu gründen.
Auf einer theoretischeren Ebene heißt das Folgendes: Wir haben auf der einen Seite eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten, die eine gemeinsame Lebenswelt teilen. In ihrem Lebensalltag sind sie von ähnlichen Problemen betroffen, die – in diesem Fall – verstärkt mit ihrer Wohnsituation zusammenhängen. Die partizipative Lösung liegt darin, die Betroffenen so zu organisieren, dass sie verstehen, wie innerhalb des gegebenen Gesellschaftssystems – also in der deutschen Gesellschaft – mit solchen Problemen umgegangen wird. Das heißt, die intermediäre Leistung besteht darin, zwischen Lebenswelt und dem System zu vermitteln. Und dies gilt eigentlich für alle Beteiligungsverfahren, die ernsthaft betrieben werden.
Abschließend fassen wir unsere Argumente in einem Thesenpapier zusammen.
Thesenpapier: Förderung der Partizipation von Zuwanderern im Stadtteil
Heterogenität der Lebenswelten – Heterogenität der Zugänge
Lebenswelten von Zuwanderern sind schicht-, bildungs- und einkommensspezifisch geprägt und vom Geschlecht, Alter und Familienstand beeinflusst. Das professionelle Handeln ist daher auf konkrete Menschen mit konkreten Ressourcen in einem konkreten Kontext abzustimmen. Patentrezepte gibt es nicht.
Beteiligungsbarrieren sind selten migrantenspezifisch
Nur ein Teil der Barrieren ist migrantenspezifisch oder kulturbedingt. Viele hindern nicht nur Zuwanderer, sondern auch Jugendliche oder sozial Benachteiligte daran, aktiv mitzumischen wie z. B.:
- Mittelschichtorientierte Beteiligungsformen (Stichwort: "Vereinsmeierei" und "Sitzungskultur")
- Die Alltagserfahrung, im Normalfall nicht gemeint zu sein – oder anders ausgedrückt: die fehlende gezielte Ansprache
- Mangelnde Information über Beteiligungsmöglichkeiten bzw. unangemessene Informationskanäle und -formen ...
Daneben gibt es Barrieren, von denen vorwiegend Zuwanderer betroffen sind, wie z. B.:
- Verständigungsprobleme und fehlende Erfahrung mit Beteiligung, weil sie im Herkunftsland evtl. nicht oder nicht in dieser Form üblich ist
- Die Erfahrung mit dominanten Verhaltenserwartungen konfrontiert zu werden (z. B. Erwartung, Treffen gemischt geschlechtlich abzuhalten, z. B. Misstrauen gegenüber eigenethnischen Unterstützungsnetzwerken)
- Diskriminierungserfahrungen: z.B. die Zuschreibung, "anders" zu sein; einhergehend damit, dass das Verhalten von Zuwanderern oft generell vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Herkunft interpretiert wird.
Was ist erforderlich, damit Zuwanderer im Stadtteil stärker partizipieren?
- Stärkere Beteiligung von Zuwanderern bedeutet eine Herausforderung für die Mehrheitsgesellschaft, sich auf ihre Lebenssituation, Ressourcen und kulturellen Besonderheiten einzulassen.
- Nur wenige Zuwanderer finden repräsentative Formen mit einer Sitzungskultur interessant. Viele können sich nur eine praxisnahe Beteiligung mit einem großen Anteil handwerklicher Tätigkeiten vorstellen.
- Gewünscht werden Mitsprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten an Projekten, die in direktem Bezug zur Lebenswelt stehen. Gefragt sind handfeste Aktionen, bei denen Erfolge frühzeitig sichtbar werden.
- Aber: es gibt kein Patentrezept! Eine allgemeingültige Aussage über Beteiligungsformen, die Zuwanderer bevorzugen, ist nicht möglich. Egal, welche Form gewählt wird, im Mittelpunkt müssen die jeweiligen Kompetenzen und Interessen stehen.
- Zuwanderer sollen von Anfang an miteinbezogen werden. Insbesondere bei der Gestaltung des Themas und der Entwicklung eines Konzepts für die Ansprache können mittels einer frühzeitigen Beteiligung Fehler vermieden werden.
- Die Ansprache sollte insgesamt so direkt wie möglich sein. Eine wichtige Rolle spielen Multiplikatoren, die die Zuwanderer direkt (in ihrer Herkunftssprache) ansprechen.
- Die Ansprache sollte differenziert erfolgen nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand, sozio-kulturellem Milieu und Migrantengeneration. Für jede Zielgruppe sollten Interessen, Fähigkeiten, Vorlieben, Informationswege und Orte des Aufenthalts erörtert werden. Aufgrund dieser Informationen kann dann eine spezifische Ansprache erfolgen.
- Wichtig ist die Darstellung von Erfolgen der Beteiligungsprojekte in der Öffentlichkeit, insbesondere in der Migrantenöffentlichkeit. Eine enge Zusammenarbeit mit der ethnischen Presse ist daher anzustreben.
Die meisten dieser Hinweise gelten generell. Migrantenspezifisch sind nur einige Ergänzungen. Daneben lassen sich zwei spezifische Hinweise hinzufügen:
- Die Ansprache und Einbindung von Zuwanderern kann durch Fachkräfte nicht deutscher Herkunft wesentlich leichter werden. Neben sprachlichen und kulturspezifischen Kompetenzen ist es die eigene Erfahrung im Umgang mit Migrationsproblemen und Diskriminierung, die das Vertrauen und Verständnis fördert.
- Vielen Zuwanderern fehlen biographische Vorerfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit, Schülervertretung, Sportverein, Parteiarbeit etc. auf die viele Einheimische aufbauen können. Dagegen sind u. U. andere Vorerfahrungen vorhanden, die nicht aus der civil society, sondern aus der familiären und dörflichen Sozialstruktur herrühren. Daran gilt es anzuknüpfen.
Fußnoten:
1) Hinte, Wolfgang/ Maria Lüttringhaus/ Dieter Oelschlägel (2001) Grundlagen und Standards der Gemeinwesenarbeit: Ein Reader für Studium, Lehre und Praxis. Münster.
2) Dieses Beispiel stammt aus der Arbeitspraxis von Gaby Straßburger, die damals als Stadtteilmoderatorin beim Institut für Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung (ISSAB) im Quartiermanagement für Essen-Katernberg tätig war.
3) Zu den Schwierigkeiten und der Notwendigkeit eines Brückenschlags zwischen Bürokratie und Lebenswelt siehe Grimm, Gaby (2004) Stadtentwicklung und Quartiermanagement: Entwicklung und Aufbau lokalspezifischer Organisations- und Steuerungsstrukturen. Essen.
4) Diese Beispiele entstammen aus der Arbeit eines Stadtteilbüros in München, wo ich (Can Aybek, damals noch Malatacik) als Sozialarbeiter tätig war. Einige der hier geschilderten Fälle haben sich allerdings vor meiner Arbeitsphase abgespielt und beruhen auf den detailreichen Beschreibungen meines damaligen Kollegen Ferdinand Mauck. Sie sind herangezogen worden, weil sie sich für die Illustration von bestimmten typischen Merkmalen in der Praxis besonders gut eignen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich herzlich bei Herrn Mauck für die Schilderungen ‚aus erster Hand’ und gemeinsamen Diskussionen bedanken. Jegliche Verantwortung für evtl. Missverständnisse oder Fehler übernehme natürlich ich (C. Aybek).
